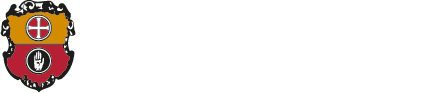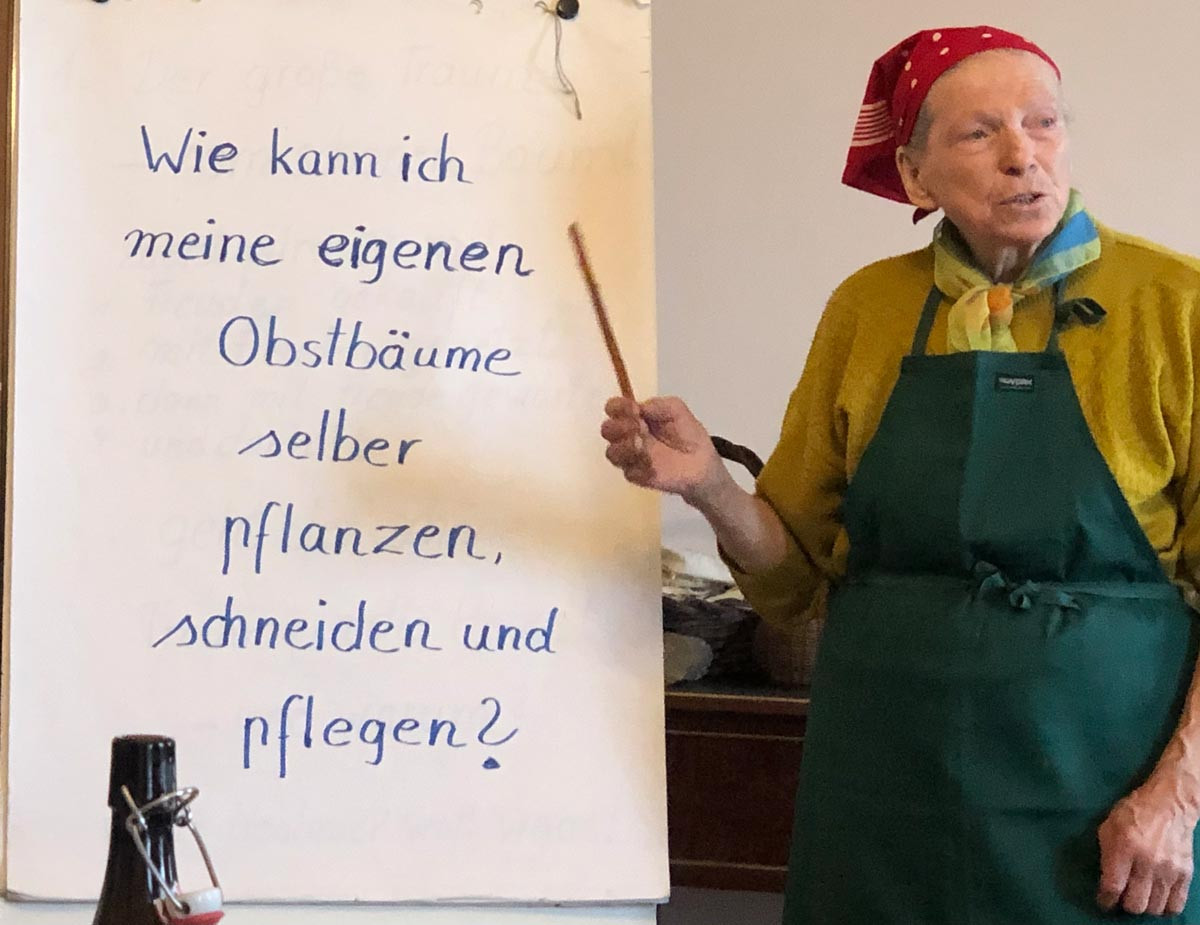Tausende Rehkitze sterben jedes Jahr in Deutschland bei der Frühjahrsmahd. Drohnen mit Wärmebildtechnik können das verhindern. So können die Tiere aufgespürt und in Sicherheit gebracht werden. Der zeitliche Aufwand ist für Landwirte wie Jäger aber groß.
Bio-Landwirt Anton Scheidel betreibt mit seinen Söhnen Jonathan, Xaver und Joshua einen großen Hof mit Mutterkuhhaltung und Ackerbau hoch über dem Dorf Wachbach (Main-Tauber-Kreis). Die Scheidels bewirtschaften rund 150 Hektar Fläche, 60 Hektar davon Grünland. Hier steht in diesen Tagen die Frühjahrsmahd an, die besonders Rehkitze gefährdet. Grund dafür ist der sogenannte Drückinstinkt in den ersten Lebenstagen. Anstatt zu fliehen, verharren die Kitze im hohen Gras reglos und flach auf dem Boden, wenn ihnen Gefahr droht. Aus der Kabine der Traktoren kann der Bauer Wildtiere im dichten Gras häufig gar nicht oder erst zu spät entdecken.
Die Scheidels haben mit dem Wachbacher Jagdpächter Ulrich Gebert einen Zeitplan erarbeitet. Kurz vor der Mahd sollen die beiden Drohnen mit Wärmebildtechnik der Kreisjägerschaft Bad Mergentheim zum Einsatz kommen. Zwischen 5000 und 7000 Euro kostet ein solches Gerät. Da sein Einsatz aktuell die beste Alternative zu bisherigen Verfahren (zum Beispiel Vergrämung, Begehung mit Hunden) darstellt, hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in den beiden vergangenen Jahren die Anschaffung von 1178 Drohnen mit bis zu 4000 Euro pro Drohne gefördert. In diesem Jahr sollen insgesamt zwei Millionen Euro dafür eingesetzt werden.
Am frühen Morgen konnten die Wachbacher Teams mit den Drohnen auf rund 20 Hektar Fläche bereits 13 Kitze vor dem Mähtod bewahren. An diesem Abend geht’s weiter. Morgens und abends zeichnet sich nämlich die Differenz zwischen der Körpertemperatur der Kitze (38,5 bis 39,5 Grad Celsius) und der Umgebung am deutlichsten ab. Am Feldweg stehen einige Jäger und Helfer mit Pappkartons und Keschern bereit. Drohnenpilot Thorsten startet das Gerät, das surrend bis in eine Höhe von etwa 50 Metern abhebt. Der Bildschirm der Drohne ist zweigeteilt – links das Wärmebild, auf dem sich Lebewesen als helle Punkte abzeichnen, rechts kann der Pilot das Flugbild verifizieren.

„Da ist was“, ruft Thorsten und zeigt auf das Display. Mit der Drohne dirigiert er die Truppe punktgenau zur Stelle der Sichtung. Gras und Klee sind fast einen Meter hoch und dicht. Dennoch hat Joshua eine Bewegung ausgemacht und stülpt rasch den Kescher darüber. Jäger Felix biegt vorsichtig die Halme zur Seite und greift mit Handschuhen und Grasbüscheln zu. Mit bloßen Händen ist das Berühren verboten – die Geiß könnte ihr Kleines sonst verstoßen. Das Kitz wehrt sich kräftig und schreit erbärmlich. „Die Kleinen bleiben liegen“, sagt der Jäger, „aber die Großen versuchen zu flüchten und laufen dann oft zurück, das ist ein Problem.“ Dann setzt er das zappelnde Tier in einen mit Gras ausgepolsterten Karton und verschließt diesen sorgfältig. Sobald die Mahd getan ist, werden die Kitze freigelassen, damit die Rehgeiß sie finden kann.

Hinter den kontrollierten Flächen startet Jonathan Scheidel die große Mähkombination. Am Ende des Abendeinsatzes haben die Drohnen zehn Hektar gecheckt und die Teams vier Kitze gerettet. „Wir mähen nur, wenn zuvor abgesucht wurde“, bekräftigt Joshua Seidel. Das Leben der Kitze ist den Bio-Landwirten der Zeitaufwand wert. Am nächsten Morgen um 4.30 Uhr geht’s weiter.
Das Video von der Rehkitzrettung sehen sie hier.