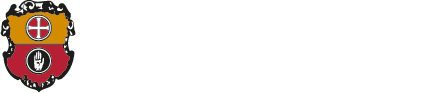Wenn die Temperaturen im Keller sind, verspürt der Mensch Lust auf Deftiges. Das ist biologisch sinnvoll, denn Fett ist Brennstoff- und Energielieferant. Schweine- oder Griebenschmalz ist heutzutage etwas aus der Mode gekommen. Doch ein Stück frisches Bauernbrot mit Schmalz schmeckt und tut einfach gut.
Fett bereichert seit jeher den Speiseplan des Menschen. Während heute die meisten zu pflanzlichen Ölen aus Sonnenblumen oder Oliven greifen, war früher Schmalz das Maß aller Dinge. Die Basis - Schweinespeck - war in Mitteleuropa die wichtigste Fett- und Energiequelle in der Ernährung. Entsprechend haben Bauern die Tiere auf einen hohen Fettanteil hin gezüchtet und gemästet. So auch die alte Landrasse der Schwäbisch-Hällischen. Die Bäuerinnen ließen das Fett der Schweine zu Schmalz aus und machten es haltbar. Zudem gewannen sie Grieben, wie der dann krosse, feste Rest des Bindegewebes genannt wird.
Unsere Vorfahren wussten noch, dass erst ein Löffel glänzend weißes Schmalz Sauerkraut einen herzhaften Geschmack verleiht, dass Bratkartoffeln damit unvergleichlich knusprig werden und dass Hausmacher Würste ohne fast nach nichts schmecken. Schmalz gehörte nicht nur in Salziges, wie das Kinderlied „Backe, backe Kuchen“ überliefert: „Wer will guten Kuchen backen, der muß haben sieben Sachen: Eier und Schmalz, Butter und Salz, Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen gehl.“
Bis in die Nachkriegszeit sorgte der hohe Anteil an Fett für den Siegeszug der alten Landrasse im Stammland. Noch 1951 gehörten im Gebiet Württemberg 49,97 Prozent aller Schweine zur Rasse der Schwäbisch-Hällischen. Ende der 1950er Jahre aber kam der Einbruch: Fettes Schweinefleisch galt plötzlich als ungesund und hatte demzufolge keinen Markt mehr. Fast hätte die Entwicklung dazu geführt, dass die alte Landrasse ausgestorben wäre – was dank des Einsatzes einiger Hohenloher Bauern rund um den Wolpertshausener Landwirt Rudolf Bühler bekanntlich verhindert werden konnte.
Schweineschmalz punktet übrigens auch ernährungsphysiologisch. Es enthält rund 60 Prozent ungesättigte Fettsäuren, davon gehören immerhin zehn Prozent zu der auf den Blutfettspiegel regulierend wirkenden Gruppe der mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Damit ist Schweineschmalz in der Zusammensetzung günstiger als Kokosöl und sogar Butter. Zudem ist Schmalz perfekt zum Braten, Backen und Frittieren geeignet. Dank seines sehr hohen Rauchpunkts verbrennt und spritzt es nicht.
Heute wissen wir: Nicht tierisches Fett ist der Hauptauslöser von Herzkrankheiten, wie lange behauptet. Es sind Zucker, Kohlenhydrate und gehärtete Pflanzenfette. Stoffe, die industriell gefertigter Nahrung zuhauf zugesetzt sind. Natürliches Fett wie auch Schmalz als Geschmacksträger gehört in die gute Küche – es kommt eben immer auf die Menge an.

Überliefert ist im Buch „Das Beste vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein“ (www.shop.besh.de) das Rezept von Johanna Bühler, ehemals Wirtin auf dem Sonnenhof in Wolpertshausen. Rückenspeck und Flomen (das zwischen Bauchfell und innerer Bauchmuskulatur liegende Fettgewebe) am besten beim Metzger des Vertrauens vorbestellen.
Griebenschmalz
Zutaten:
- 1000 g Rückenspeck (grüner Speck) vom Schwäbisch-Hällischen Schwein g.g.A. (EU-geschützte geografische Angabe
- 500 g Flomen vom Schwäbisch-Hällischen Schwein g.g.A.
- 4 EL Wasser
- 1 Zwiebel
- 125 g Apfelwürfel
- 125 g Zwiebelwürfel
- 1 TL Wacholderbeeren
2 Nelken - Salz, Pfeffer
Zubereitung:
- Rückenspeck und Flomen in Streifen schneiden und durch die grobe Scheibe des Fleischwolfs lassen.
- Mit Wasser, ganzer Zwiebel, Apfelwürfeln und den Gewürzen in eine Kasserole oder Pfanne mit hohem Rand geben. Auf kleiner Flamme unter Rühren schmelzen lassen.
- In der Zwischenzeit die Zwiebelwürfel goldbraun rösten.
- Sobald beim Schmalz die Grieben oben schwimmen, die ganze Zwiebel herausnehmen. Die gerösteten Zwiebelwürfel zugeben, gut verrühren und mit Salz sowie Pfeffer abschmecken. Nach Belieben mit etwas Majoran verfeinern. In sterile Steinguttöpfe oder Gläser abfüllen und kühl aufbewahren.
Wir wünschen guten Appetit!