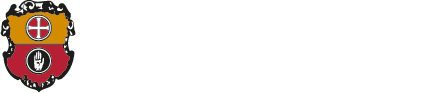20 Prozent des Futters von Schwäbisch-Hällischen Weideschweinen besteht aus Eicheln. Damit die Früchte die Weidesaison über verfügbar sind, ruft die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall alljährlich zur großen Sammelaktion auf.
„Runter vom Sofa und raus in die Wälder!“ So motiviert Rudolf Bühler, der als Retter der alten Landrasse gilt, Jung und Alt, für eine gute Sache und gutes Geld in der Natur aktiv zu sein. Bei Abgabe von sauberen und trockenen Eicheln im Regionalmarkt Hohenlohe in Wolpertshausen gibt‘s pro Kilogramm 0,60 Euro in bar oder als Gutschein.