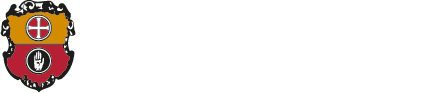Eine Grillparty ohne Fleisch ist für die meisten undenkbar. Einer Umfrage zufolge liegen Steaks und Grillwürste bei den Deutschen unangefochten auf Platz eins. Bei der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall kommen Fleisch- wie Wurstfreunde auf ihre Kosten.
Thomas Simon, 34, leitet die Wurstproduktion der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Unter seiner Verantwortung werden „die gesamte Darm-Ware, Saitenwurst, Aufschnitt-Wurst und geräucherte Wurst“ produziert, zählt der Metzgermeister auf. Zur Darm-Ware (das heißt, in Naturdärme gefüllt) gehören auch die beliebten Grillwürste: „Die laufen vor allem jetzt, im Sommer.“
Genießer haben die Qual der Wahl: Zehn verschiedene Grillwürste hat das Team von Thomas Simon regelmäßig im Programm. Bratwurstschnecke, grobe Bratwurst, Lammbratwurst, Merguez, Salsiccia und Feuerwurst gehören zu den Rohwürsten, Rostbratwurst, Kräuterbratwurst, Nürnbergerle und feine Bratwurst sind gebrühte Würste. Diese garen nicht im Kessel, sondern werden im Wasserdampf fertiggestellt.
„Alle unsere Würste kommen ohne Pökelsalz aus“, betont der Metzgermeister. Die feinen Naturgewürze für die Grillwürste und das Meersalz stammen von der Gewürzmanufaktur Ecoland Herbs & Spices. Dieter Mayer, der legendäre Metzgermeister und Produktentwickler der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, hat seinerzeit die Rezepturen entwickelt, an denen sich Simons Team noch heute orientiert. So verfeinert die Salsiccia beispielsweise ein wenig Rotwein, die Lammbratwurst wird mit etwas Rosmarin gewürzt. Die genauen Rezepte bleiben freilich das Geheimnis der Hohenloher Metzger.

Für die Merguez braucht’s ausschließlich Hohenloher Qualitätsfleisch vom Rind, in die Lammbratwurst kommt jeweils zur Hälfte Fleisch vom Hohenloher Lamm und Hohenloher Rind, die Feuerwurst besteht halb aus Rind-, halb aus Schwäbisch-Hällischem Qualitätsschweinefleisch. Die anderen Würste beinhalten ausschließlich das von der EU als „geschützte geografische Angabe“ ausgezeichnete Schweinefleisch. Früh am Morgen produzieren die rund 13 Männer und Frauen im Team die Grillwürste. „Gestern früh wurde geschlachtet, am Abend ist das Fleisch zu uns gekommen und jetzt wird es verarbeitet“, erklärt der Metzgermeister. Bei Rohwaren sei es wichtig, nur frisches Fleisch einzusetzen: „Und gut durchgekühlt muss es sein.“

Wie das frische Brät, das einer seiner Mitarbeiter in einem Edelstahlbehälter zum Wurstfüller schiebt. „Das Fleisch ist grob gewolft und mit Gewürzen und Salz vermengt, nicht gekuttert“, sagt Thomas Simon: „So sieht man, was in der Wurst drin ist.“ Von nun an ist Handarbeit angesagt. Ein Metzger stülpt den Naturdarm über das Rohr und setzt die Maschine in Gang. Im Sekundentakt spuckt das Gerät Stück für Stück die groben Bratwürste aus, die der Mann routiniert abnimmt. Sein Kollege trennt die Schlangen zu Einzelwürsten, eine Mitarbeiterin legt sie in Schalen. „Unter Schutzatmosphäre“ (das heißt ohne Sauerstoff) verpackt, sind die Grillwürste versandfertig – für die Kantinen großer Unternehmen beispielsweise, für die Fachmetzgereien, die ihre Waren von den Hohenloher Bauern beziehen oder für die Märkte der Erzeugergemeinschaft sowie den Webshop.

1,5 bis 2 Tonnen Fleisch pro Tag werden in der Wurstproduktion verarbeitet. Und was kommt bei Thomas Simon auf den Grill? Der Metzgermeister muss nicht lange überlegen: „Bratwurstschnecken – die sind dünner und schmecken mir am besten.“
Grillwürste und andere Grillspezialitäten sind in den Märkten der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall zu haben oder über den Webshop zu beziehen: www.shop.besh.de