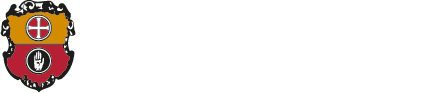Ukrainekrieg und Klimawandel stellen die Landwirtschaft in Deutschland vor gewaltige Herausforderungen. Angesichts drohender Hungersnöte konventionelle und ökologische Landwirtschaft gegeneinander auszuspielen ist der falsche Weg, sagt Markus Ehrmann: „Wir brauchen beides, Nahrungsmittelproduktion und vielfältige Agrarlandschaften.“
Markus Ehrmann ist promovierter Agrarwissenschaftler und aktiver Landwirt der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Er züchtet und mästet auf einem konventionell betriebenen Hof in Herbertshausen bei Rot am See Schwäbisch-Hällische Schweine und betreibt Ackerbau. Zudem vermehrt er auf rund 35 Hektar gebietseigene Wildblumen und -gräser für die Firma Rieger-Hofmann (www.rieger-hofmann.de). Die drei Betriebszweige ergänzen sich: „Biologische Vielfalt ist der richtige Weg“, davon ist Ehrmann überzeugt. Ob bio oder konventionell: „Wir alle müssen nachhaltig intensivieren.“